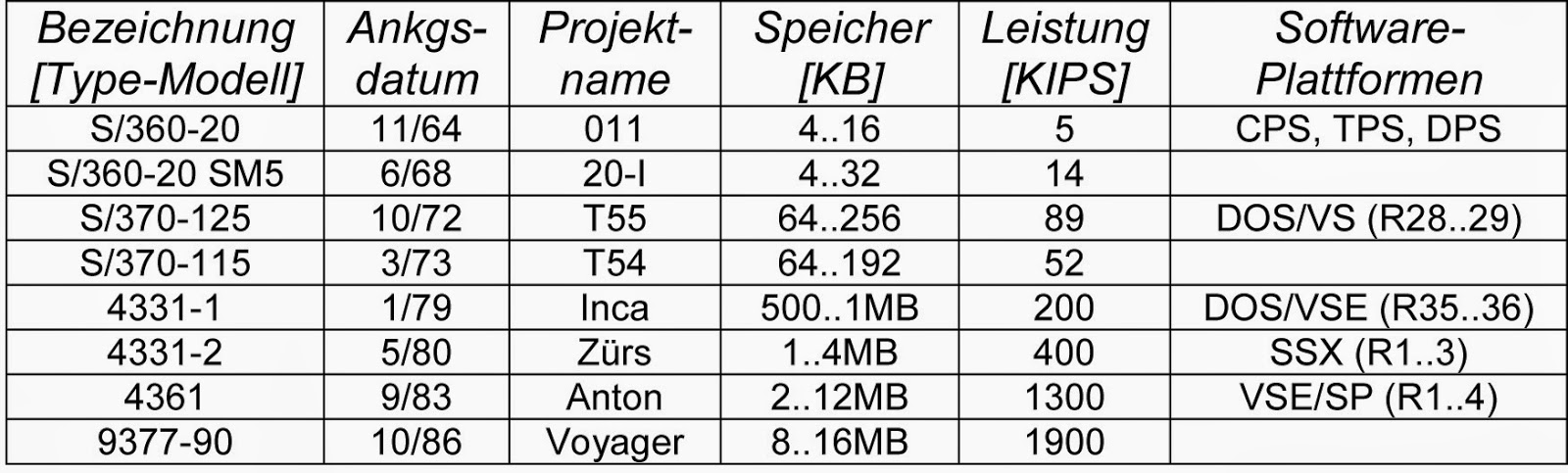Edwin Vogt (Jahrgang 1932) war von 1961
bis 1996 im Entwicklungsbereich der IBM Deutschland tätig. Nach einem
Algol-Projekt 1962-1963 im französischen Labor in La Gaude folgte eine
Abordnung in die USA. Von 1967 bis 1984 war er Leiter der Systementwicklung des
Böblinger Labors und verantwortete die Entwicklung mehrerer IBM
Rechnerfamilien. Zu erwähnen sind das System/360 Modell 125 sowie die Systeme
IBM 4331, 4361 und 9377. Über mehrere Jahre hinweg schloss seine Verantwortung
auch die maschinen-nahe Software-Entwicklung mit ein, d.h. das Betriebssystem
DOS/VSE. Im Jahre 1987 übernahm er die Leitung des
Programm-Entwicklungszentrums (PPDC) Sindelfingen. Daraus entstand ein eigenes
Anwendungsentwicklungslabor mit weltweiter Produktverantwortung im Datenbank-
und Data-Warehouse-Bereich.
Nach seiner Pensionierung im Jahre 1996
wurde Vogt zum Geschäftsführenden Vorstand einer Startup-Förderinitiative
ernannt. Das Softwarezentrum Böblingen/Sindelfingen e.V. ist eine vom Land Baden-Württemberg,
der örtlichen Bezirkskammer der IHK und den Städten Böblingen und Sindelfingen
Ende 1995 initiierte Organisation. Vogt leitete sie bis August 1999. Danach
wurde er Vizepräsident Forschung & Entwicklung für Xybernaut, einer Firma,
die Rechner baute, die bei Montage-Arbeiten am Körper des Monteurs getragen
werden. Seit April 2011 ist er Leiter der Basketballabteilung der Böblingen
Panthers. Vogt ist promovierter Elektrotechniker der Universität Stuttgart.
Familie Vogt hat drei erwachsene Söhne, acht Enkel und einen Urenkel.
Bertal
Dresen (BD): Wir kennen uns seit unserer gemeinsamen Zeit vor über 50 Jahren im
französischen Labor der IBM. Das war bei einem Software-Projekt in La Gaude an
der Côte d’Azur unweit von Nizza. Wir lassen diese Wanderjahre einmal außen vor
und beginnen mit der Prozessoren-Entwicklung in Böblingen. Damit Sie einen
Bezugspunkt haben, stelle ich einen Auszug aus einer Tabelle vorne weg, die
sich (ohne die Software-Spalte) in Helmut Painkes Buch [1] (Seite 167)
befindet. Sie können dann frei zwischen Produktbezeichnung und internem
Projektnamen wechseln. Was war der erste technische Höhepunkt, an den Sie
sich erinnern?
Edwin
Vogt (EV): Meine Zeit als Leiter der Prozessoren-Entwicklung, intern meist Systementwicklung
genannt, begann 1967 mit der Entwicklung des System/360 Model 20 Submodel 5
(Codename 20-I). Diese war das erste ausgelieferte System, in dem der Kontrollspeicher
für die Mikroprogrammierung in den Datenspeicher integriert war. Ein prototypischer
Vorläufer (Codename M10) unter meinem Vorgänger Wilhelm
Spruth hatte diese Technologie erstmals angewandt. Dies erlaubte auch die
Mikroprogrammierung durch Entwicklungsverfahren zu unterstützen, die in der Software
Stand der Technik waren.
Wir haben damals einen Interpreter für die kommerzielle Programmiersprache
RPG (Report Program Generator) direkt im Mikroprogramm (unter dem Codenamen
GOML) implementiert. Die 20-I lief dann als RPG-Maschine fantastisch. Die IBM
hat aber die Auslieferung gestoppt, weil die 20-I in diesem Modus schneller war
als die größeren Modelle 30 und 40 des Systems/360 und gleichzeitig das kleine
kommerzielle Systeme/3 der späteren General Sytems Division (GSD) überflüssig gemacht hätte.
BD: Sie heben sofort
die interne Konkurrenz hervor. Fast kann man meinen, dass diese wichtiger war
als die externe Konkurrenz. Dieser Vorwurf wurde uns IBMern damals häufig
gemacht. Halten Sie ihn für berechtigt?
EV: Dieser Vorwurf ist berechtigt.
Die IBM war in „Divisions“ aufgeteilt, die bestimmte Hardwareproduktbereiche
und als Anhängsel ein dazugehörendes Betriebssystem abdeckten. Wir gehörten zur
Data Systems Division (DSD) und beackerten hier das untere Ende dieses
Bereichs. Poughkeepsie hatte das obere Ende und Endicott den mittleren Bereich.
Diese beiden viel größeren Labors, die auch das Division Management stellten,
hatten kein Interesse sich mit anderen Systemlabors (wie Rochester oder San
Jose) anzulegen. Bob Evans [damals Vizepräsident
und Entwicklungschef der DSD] versuchte dies, war aber nicht erfolgreich, da
das Corporate Management angesichts der Profitabilität der IBM und ihrer Marktmacht
im Computerbereich, diese Produktproliferation als nicht kritisch ansah. Es gab
sogar Personen, speziell im Marketing- und Forschungsbereich, die ̶ etwas arrogant und kurzsichtig ̶ diese
sogar positiv unterstützten nach dem Motto „Wenn wir schon keine externe Konkurrenz
haben, machen wir dies intern“.
BD: Zurück ins Böblinger Labor. Was beschäftigte
Sie als nächstes?
EV: Die Modelle 125 und
115 des Systems/370 waren die ersten Computersysteme, in denen die System/370-Architektur
durch ein mikroprogrammiertes Multiprozessorensystem, mit eigenem Speicher per
Prozessoreinheit, realisiert wurden. Dabei wurden die Mikroprogramme in
Verbindung mit einem Serviceprozessor über eines der ersten zur Verfügung
stehenden Diskettensysteme (IGAR) in die einzelnen parallel laufenden
Prozessoren geladen und so das Gesamtsystem initialisiert (engl. bootstrapping).
Die einzelnen Prozessoren waren auf ihre Aufgaben zugeschnitten, so der Serviceprozessor
(SVP), die I/O-Prozessoren und die Instruction
Processing Unit (IPU). Ihr Zusammenspiel wurde über den SVP koordiniert. Das
war eine technologische Entwicklung, die weit über damals implementierten CPU-Strukturen
hinausging.
BD: Zwischen dem
Modell 115 und der IBM 4331 liegen fast sechs Jahre. Das war die berühmt-berüchtigte
FS-Zeit. Die Ziele der FS-Architektur hatte ich in einem Nachruf auf George Radin in diesem Blog erklärt.
Was verbinden Sie mit FS? Waren es wirklich völlig verlorene Jahre aus
Böblinger Sicht?
EV: Das FS-Projekt
trieb die Computer-Technologien voran in Bezug auf Architektur und
Programmierung. Für die Prozessoren-Entwicklung selbst aber waren es verlorene
Jahre, welche die IBM nur auf Grund ihrer Markmacht überlebte. Die 4331-1 war
meiner Ansicht nach das größte Geheimprojekt (engl. bootlegging) in der
IBM-Geschichte und nur so gelang es nach mehr als vier verlorenen Jahren ein
System innerhalb kürzester Zeit (18 Monate) auf den Markt zu bringen. Dieses
System war voll S/370-kompatibel.
BD: Mit der IBM 4331
verbinde ich zwei technische Problemstellungen, mit denen wir beide gemeinsam
zu kämpfen hatten, die spezielle Rechnerarchitektur für die kleinen Systeme der
System/370-Familie, E-Mode genannt,
und die Plattenarchitektur, als Fixed
Block Architecture (FBA) bekannt. Der E-Mode bot einen einzelnen in Mikrocode
realisierten virtuellen Adressraum von 16 MB an. Durch FBA wurden Magnetplatten
mit fester Blocklänge (damals 512 Bytes) beschrieben. In beiden Fällen ging es
darum, Hardware-Kosten zu sparen, teilweise zu Lasten einer speziellen Software-Entwicklung.
Ich sehe dies als Tradeoff, der nur in einer spezifischen Phase unserer
Technologie zu rechtfertigen war. Sehen Sie dies auch so? War die Koppelung der
Böblinger Hardware nur an das Betriebssystem DOS/VS nicht zu einschränkend, wo doch bereits viele
Nutzer mit Hilfe von VM/370 alternative Software-Umgebungen betrieben?
EV: Ich sehe die
angeführten Punkte nicht ganz so. Der E-Mode für die S/370-Systeme war am
Anfang durch die Hardware-Kosten getrieben. Die 4331 war aber schon voll S/370-kompatibel.
Das dadurch entstandene Betriebssystem DOS/VSE hätte sehr wohl als einziges
Eingangssystem der IBM dienen können. Dies wurde aber verpasst, weil die DOS/VSE-Entwickler
nicht erkannten, dass in diesem Bereich die Benützbarkeit wichtiger ist, als die
funktionelle Komplexität. Dadurch entstanden zur S/370 inkompatible Architekturen
und Betriebssysteme, die nicht notwendig gewesen wären. Die FBA-Architektur war
durch die Plattentechnologie getrieben. Sie hätte ohne weiteres später als Teil
einer Erweiterungsstrategie benützt werden können, was ja auch zum Teil
geschehen ist.
BD: An der obigen
Tabelle ist sehr schön zu sehen, wie die Leistungsfähigkeit Böblinger Systeme
wuchs. Schließlich gab es auf der Hardware-Seite keinen Unterschied mehr zu den
Großsystemen, was die Architektur der Systeme betraf. Was kennzeichnete diese
Systeme?
EV: Die IBM 4361 (intern
Anton genannt, nach dem Skiort St. Anton), als Weiter-entwicklung der 4331, war
der erste IBM-Rechner, bei dem die Bedienerkonsole ein Bildschirm war, der am
Serviceprozessor angeschlossen war. Sowohl das Betriebssystem als auch die
Mikroprogramme, inklusive der Hardware-Wartungsprogramme,
konnten von hier aus gesteuert werden. Für die IPU wurde ein Konzept für den S/370-Instruktionssatz
entwickelt, bei dem ein sogenannter RISC-Instruktionssatz direkt in Hardware
implementiert wurde. Nur die komplexeren Instruktionen wurden per Mikroprogramm
ausgeführt. (Weitere Details beschreibe ich bei der späteren Frage über RISC-Prozessoren).
Dass dieses Konzept in der IBM nicht erkannt und vorangetrieben wurde,
bezeichnete Jack
Kuehler [damals IBM Vizepräsident] später als seinen größten Fehler in
seinen technologischen Entscheidungen. Die 4361 war in ihrer Leistungsfähigkeit
(gemessen als Leistung pro Anzahl der Schaltkreise) allen IBM-Systemen in diesem
Zeitraum so überlegen, dass wir ̶ in einer speziellen durch die Corporation eingesetzten
Taskforce ̶ den Entwicklern aus Poughkeepsie,
Endicott und Rochester unseren Designs erklären mussten. Man hat das 4361-Konzept
als „best of breed“ anerkannt, aber in den anderen Labors wurden daraus keine
Lehren gezogen.
BD: Welche ehemaligen Kollegen
trugen den maßgeblichen Anteil an dem Erfolg der Systementwicklung? Mit welchen
andern Labors der Firma bestanden intensive Kontakte?
EV: Wichtig war für
mich ein Team zu haben, das ich an die durch den schnellen technologischen
Fortschritt gegebenen Möglichkeiten heranbringen konnte. Die Struktur des Teams
musste so aufgebaut sein, dass es Personen gab, die mich hierbei kritisch
begleiteten (z.B. Helmut Painke und Günter Knauft), aber auch Personen
beinhaltete die entweder die vorgegebene Richtung dann umsetzen konnten (z.B. Leo
Reichl und Horst von der Hayden) oder die auf Grund ihrer technischen Brillanz
einsame Spitze waren (z. B: Johann Hajdu und Hans-Hermann Lampe) und Personen
mit denen ich dies zu einer Gesamtlösung zusammenbringen konnte (z.B. Helmut
Weber und Karl-Heinz Strassemeyer). Diese Entwicklung war auch durch die engen
Kontakte mit der Technologieentwicklung des Labors (die Kollegen Folberth und Spielmann)
möglich. Es bestanden weiterhin enge Kontakte zu den Labors in Endicott und Poughkeepsie,
in Teilen zur Technologieentwicklung in East-Fishkill und zu Research Centers
in Yorktown Heights und Almaden.
BD: In der Frage,
welche Rolle die RISC-Architektur spielen sollte, waren Sie und George Radin geteilter
Meinung. Können Sie in wenigen Sätzen den damaligen Disput beschreiben?
EV: Wie bereits
gesagt, hatte die 4361-IPU einen RISC-Instruktionssatz der aus einer Untermenge
der S/370 Instruktionen vom Typ RR, RX und SI bestand. Dieser Instruktionssatz
war für den sogenannten „Commercial Instruction Mix“ nur 2-3% langsamer als der von Radin entwickelte, der
auch nach dem damaligen Data General Commercial Rating (DGCR) gemessen wurde. Er
war auch im Implementierungsaufwand (Schaltkreise/DGCR) absolut
konkurrenzfähig. Dies passte Radin und anderen Research-Gurus nicht. Deshalb
wurde nie der Versuch unternommen, auf diesem Instruktionssatz basierend, auf
der S/370/125 UNIX laufen zu lassen, darauf die DG-Software-Systeme zu
konvertieren oder diesen auf Effektivität mit den beim System/1800, dem System/36
und dem späteren System/38 und AS/400 benützten Architekturen zu vergleichen.
Wir wussten, dass wir im Durchsatz besser oder zumindest gleich gut wie diese
Systeme gewesen wären.
Die
IBM hätte in diesem Fall große Teile
ihrer Ressourcen in Research und in GSD nicht mehr gebraucht und hätte immense
Mengen an Geld sparen können und sich für Konkurrenzsoftware zu diesem
Zeitpunkt öffnen können. Dazu war die IBM Managementstruktur zu wenig flexibel,
technisch, in vielen Fällen, zu inkompetent und viel zu stark nach innen orientiert. Ich habe nur zwei Manager kennengelernt, die dies verstanden haben: Jack
Kuehler und Earl Wheeler [Wheeler stammte aus
der DOS-Entwicklung in Endicott und leitete später das gesamte
Software-Produkt-Geschäft der IBM]. Beide haben mir in Gesprächen nach ihrer Pensionierung
bestätigt, dass sie die Nichtverfolgung dieses Zieles als einen ihrer größten
Fehler sahen und sie die Durchsetzung dieses Konzepts auch unterlassen haben,
weil sie nicht gegen den Rest der IBM antreten wollten.
BD: Von Bob Evans [2] stammt
die Aussage, dass IBM auch im PC-Geschäft hätte erfolgreich sein können, wenn
man voll auf RISC-Mikroprozessoren gesetzt hätte, und zwar unter Beibehaltung
aller Software-Rechte. Was wäre, wenn…? Solche Diskussionen sind zwar meist
fruchtlos. Dennoch würde mich interessieren, welche Gründe Sie für IBMs
Rückgang im Hardware-Geschäft anführen würden. Welche Fehler wurden von unsern
ehemaligen Hardware-Kollegen gemacht? Welche Rolle spielten externe Einflüsse?
EV: Bob Evans hat
vollständig recht: Nur noch ein zusätzlicher Kommentar: IBM kam hier in
Schwierigkeiten, weil sie keine Struktur und zu wenige Manager hatten, die
gesehen hätten, dass das Vorantreiben der Technologien interne Strukturveränderungen
erfordert. IBM war zu einer Bürokratie degeneriert, in der die Bürokraten, als inkompetente
Produktplaner und Produktmanager getarnt, den Fortschritt verhinderten. Die Wenigen,
die dies hätten noch ändern können, hatten keine Chance sich durchzusetzen und haben
zum Teil dies auch nicht versucht. Tödlich für die IBM war hier das Fehlen
einer technisch kompetenten Person (wie z.B. Fred Brooks bei der S/360-Architektur),
der die Hardware und Software in ein umfassendes System forciert hätte. Jack
Kuehler [von der Plattenentwicklung kommend] hatte hier zu wenig Software-Hintergrund,
Bob Evans hatte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr den Einfluss, um dies
weitertreiben und umsetzen zu können. Die Größe der IBM und ihre Inflexibilität
über Organisationsstrukturen hinweg machten sich hier bemerkbar.
BD: Während Ihrer Zeit
als Leiter des PPDC und auch nach Ihrer IBM-Zeit waren Sie vorwiegend im Software-Geschäft
tätig. Kann man daraus schließen, dass Sie der Software ein größeres Potenzial
beimessen als der Hardware, oder ist es nur der Ausdruck Ihrer Vielseitigkeit? Teilen
Sie die Meinung, die auch unser Ex-Kollege Karl-Heinz
Strassemeyer in diesen Blog vertrat, dass eine Firma, die nicht eine Gesamtsystemsicht
vertritt, also Hardware und Software als Einheit betrachtet, einen Fehler
macht? Hat IBM nicht zu lange und zu sehr das von Hardware unabhängige Software-Geschäft
unterschätzt? Rettete nicht der von Earl Wheeler aufgebaute und später von Steve Mills geleitete
Software-Bereich in den letzten Jahrzehnten die IBM vor dem Bankrott? Wie sehen
Sie heute die Beziehung von Hardware und Software und die Zukunft der IBM als
Teil der Software-Branche?
EV: Ich verließ 1987 die
Systementwicklung und das Böblinger Labor und übernahm in der IBM Deutschland
als Direktor die Planungs- und Softwareaktivitäten. Das schloss das Program
Product Development Center (PPDC) in Sindelfingen mit ein. Dieses nahm organisatorisch
eine Zwitterstellung ein, indem es Softwareprodukte entwickelte, aber nicht
wirklich in die Organisation der IBM Software-Produktentwicklung integriert
war. Meine Kontakte in die US-Entwicklungsorganisationen und das Corporate
Management halfen mir, diese Entwicklungsgruppe weiter auszubauen und den unkontrollierten
Wildwuchs von Softwareaktivitäten innerhalb der IBM Deutschland zu straffen.
Ich
betrachte aber diesen Wechsel in die IBM Deutschland als meinen größten Fehler
in meiner IBM-Laufbahn, da ich mich in einer aufgeblähten, rein durch Vertriebsanreize
getriebenen Marketingorganisation wiederfand. Nachdem man mir die Planungsaktivitäten
weggenommen hatte, wollte ich die IBM verlassen. Ich besprach dies mit Earl
Wheeler im Februar 1990 in Berlin und er bot mir einen Job an, der alle Softwareentwicklungsaktivitäten
seiner Organisation in Europa unter meiner Leitung konsolidierte. Dies betraf
die Labors in Dublin, Warwick, Wien und das PPDC, das auch weitgehend von ihm
finanziert und später als German Software Development Lab (GSDL) in diesen
Verbund integriert wurde. Im März 1990 informierte Earl Wheeler in einem kurzen
Schreiben den damaligen Geschäftsführer der IBM Deutschland (Hans Olaf Henkel) über
diese Organisationsänderung.
Bis
zu dem mit meiner Pensionierung verbundenen Ausscheiden aus der IBM Ende 1995
berichtete ich an Earl Wheeler und an seinen Nachfolger Steve Mills. Ich konzentrierte
die Aktivitäten der genannten Labors auf Datenbankaktivitäten, Dokumentenmanagement
und neu hinzukommend Workflowmanagement. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen
unter Lou Gerstner mussten wir in den folgenden Jahren Dublin, Warwick und am
Schluss auch Wien schließen und diese Aktivitäten im GSDL konsolidieren. Im
Zeitraum von 1990 bis 1995 war übrigens das GSDL die einzige
Entwicklungsorganisation innerhalb der gesamten IBM, die wuchs. Besonders unter
Steve Mills wurde die Softwareorganisation stark ausgebaut und ohne diese
erfolgreiche Organisation hätte es die IBM nie geschafft, sich von einer fast ausschließlich
von Hardware getriebenen Organisation in ein durch Orientierung auf Software
und Service erfolgreiches Unternehmen umzuwandeln.
BD: Das Softwarezentrum
Böblingen-Sindelfingen (SBS) ist eine Gründung der beiden benachbarten Städte. Obwohl
deren Zusammenarbeit sonst oft schwerfällt, hier scheint sie zu klappen. Worauf
führen Sie den anhaltenden Erfolg des Zentrums zurück? Welches Profil haben
typische Firmengründer? Was ist ihr Geschäftsmodell? Woher kommen die Aufträge?
Welche Rolle spielen Hardware-Projekte? Gab es auch Probleme und Misserfolge?
EV: Als ich Ende 1995
mit 63 Jahren aus der IBM ausschied, wurde mir angeboten das SBS aufzubauen, das in
einem von der IBM aufgegebenen Laborgebäude für Bankenterminalentwicklung
untergebracht war. Diese Organisation sollte in Form eines Vereins, kleine neuzugründende
Softwareunternehmen unterstützen und ihnen eine Infrastruktur für deren
erfolgreichen Aufbau anbieten. Diese Vorhaben wurde vom Land Baden/Württemberg
(unter Erwin Teufel als Ministerpräsident und Dieter Spöri als
Wirtschaftsminister) über eine Anfangsfinanzierung unterstützt, wurde in der IHK
organisatorisch verankert und vorangetrieben, von Daimler-Benz, HP und IBM als
mögliche Projektlieferanten unterstützt. Es erhielt von den Städten Böblingen
und Sindelfingen positiven Beistand als Teil ihrer Industrieansiedlungspolitik.
Von
Anfang an wurde der Fokus ausschließlich auf die Software-getriebene Serviceentwicklung
gelegt und Firmen in den Verbund aufgenommen, die diese Aufgabe entweder direkt
oder indirekt wahrnahmen. Außerdem mussten sie willens sein mit anderen
Firmenpartnern im SBS-Verbund zu kooperieren. Hardware orientierte Entwicklungen
waren dabei nur als Träger für neue Softwaretechnologien interessant. Zusätzlich
wurde diesen Firmen in der Projektfindung von in der Region ansässigen Großfirmen
wie Daimler, HP und IBM aktiv unterstützt. Diese Auswahlkriterien und die damit
verbundene Firmenselektionen wurden rigoros durchgesetzt und Verwässerungen
durch Einflussnahme von außen (Kommunen, IHK und politische Gremien) minimiert.
Diese Vorgehenswiese war und ist der Schlüssel zum Erfolg des SBS.
Im
SBS waren bei meinem Ausscheiden 42 Firmen mit 220 Mitarbeitern angesiedelt.
Diese Zahlen wuchsen bis heute auf 110 Firmen mit 750 Mitarbeitern an. Dabei wuchsen
einige Firmen so stark, dass sie nur noch ihren Hauptsitz im SBS haben, wie Spirit/21
mit heute 500 Mitarbeitern, oder dass sie aus dem SBS in eigene Gebäude umzogen
wie die Compart AG mit heute 200 Mitarbeitern.
BD: Sie waren bzw.
sind auch selbst an einer der dort ansässigen Firmen beteiligt. Welche
ist das? Was tut sie? Welche Aufgaben haben Sie?
EV; Während meiner
Zeit als Leiter des SBS wurde ich von vielen Firmen angesprochen, die mich als Geschäftsführer
(CEO), Entwicklungsleiter oder Berater einstellen wollten. Das für mich
interessanteste Angebot kam von dem amerikanischen Unternehmen Xybernaut, die
in Fairfax, VA, beheimatet war und absoluter Technologie- und Marktführer auf
dem Segment des Mobile & Wearable Computing war. Da ich mit meiner Familie
nicht nach Amerika gehen wollte, verlegte diese Firma ihre vollständige
Entwicklung in eine deutsche Tochter, die im Softwarezentrum angesiedelt wurde
und ernannten mich zum Entwicklungschef als Senior Vice President der Xybernaut
Corp. Die Übernahme dieser für mich sehr interessanten Aufgabe erforderte, dass
ich im Jahr 1999 die Führung des SBS aufgab und mich nur noch dieser Aufgabe
widmete.
Dieses
Arbeitsgebiet war sehr interessant und auf mein Wissen und meine Erfahrung
zugeschnitten. Wir waren an der Vorderfront der technologischen Entwicklung und
den Marktgegebenheiten etwa fünf bis zehn Jahre voraus Die Firma Xybernaut hatte
nicht die Kapitalkraft um die Zeit, bis ein profitables Geschäft daraus möglich
war, zu überstehen. Als die Mutterfirma
2005 in Insolvenz ging, löste ich die deutsche Tochter aus dieser Firma heraus und
übernahm sie als persönlich haftender Eigentümer. Sie heißt teXXmo Mobile
Solution GmbH & Co KG. Die Firma arbeitet heute als profitables Unternehmen
mit einem guten Ruf auf dem mobilen industriellen Sektor in Europa und ist
immer noch im SBS angesiedelt.
BD: Wer Sie vor
40 Jahren in Ihrem Büro aufsuchte, dem konnte passieren, dass er ins Testlabor
geschickt wurde. Dort konnte man Sie dann im weißen Hemd und mit Krawatte
hinter einer Maschine liegend finden. Sie gaben gerade einem Techniker
Hinweise, der aufgelötete Schaltverbindungen überprüfte. Sind Sie immer noch der
Ingenieur, der auch im Alter gerne selber mit Hand anlegt?
EV: Ja, das mir macht
mir immer noch Spaß.
BD: Lange nach
Beendigung Ihrer aktiven Zeit als Basketballer leiten Sie eine örtliche Basketball-Abteilung.
Ist das ein Ausgleich für einen Manager oder ist es die gleiche Tätigkeit, nur
mit andern Leuten und anderen Zielen? Demgegenüber muss doch das Schnapsbrennen
aus den eigenen Mirabellen zu hervorragenden geistvollen Produkten zu führen. Oder
kann nur das Golfspielen sie wirklich entspannen?
EV: In die Leitung der
Basketballabteilung wurde ich von alten Basketballkollegen getrieben, da die
Gefahr bestand, dass die Abteilung auseinander bricht. Leider habe ich den
Eindruck, dass ich das zu gut mache und ich daher nicht wieder richtig aus der
Sache herauskomme. Beim Schnapsbrennen als meinem dritten „Standbein“ kommt
meine in erster Generation schwäbische Seele zum Vorschein: „Ja nichts
verderben lassen!“ ist das Motto. Beim Golfspielen entspanne ich tatsächlich
und meine Frau und ich haben gemeinsam viel Spaß dabei.
BD: Herr Vogt, ich
danke Ihnen sehr für das ausführliche Interview und wünsche Ihnen weiterhin Erfolg
bei all ihren Geschäften.
Zusätzliche Referenzen
- Painke, H.: Forschung und Entwicklung in der IBM Deutschland. 4. Die IBM Laboratorien Böblingen: System-Entwicklung. 2003
- Evans, B. O.: The Stumbling Titan. In: P. J. Denning, R. M. Metcalfe: Beyond Calculation. The Next Fifty Years of Computing. 1998