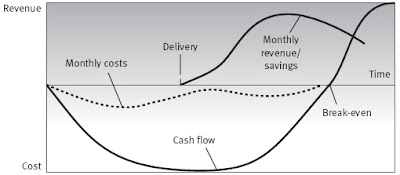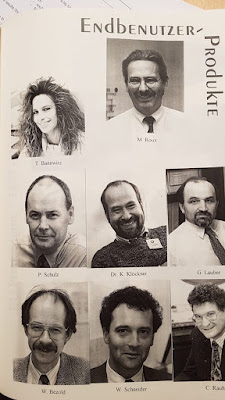In
einem gedruckten Artikel im Jahre 2006 [1] und in einem Blog-Beitrag des Jahres
2016 befasste ich mich mit dem Thema Geschäftsmodelle. Ich kann dieses
Thema allen Ingenieuren und Informatikern nur sehr empfehlen, erst Recht den
Wirtschaftsinformatikern. Vor allem Technik-Begeisterte lassen sich leicht dazu
verleiten zu glauben, dass schon eine gute technische Idee genügt, um
wirtschaftlich Erfolg zu haben. Leider ist es nicht so. Lassen Sie es sich
erklären.
Was
ist ein Geschäftsmodell?
Ein
Geschäftsmodell (engl.: business model)
beschreibt, wie man aus einer Idee zu Geld kommt. Der Definition von Oliver Gassmann
[2] folgend muss das Geschäftsmodell vier grundsätzliche Fragen beantworten,
nämlich:
- Wer ist der Kunde?
- Was bietet man an?
- Wie wird die Leistung erbracht?
- Wie wird der Wert erzielt?
Das
Geschäftsmodell bestimmt, (1) was eine Organisation anbietet, das von Wert für
Kunden ist, (2) wie Werte in einem Organisationssystem geschaffen werden, (3)
wie die geschaffenen Werte dem Kunden kommuniziert und übertragen werden, (4)
wie die geschaffenen Werte in Form von Erträgen durch das Unternehmen
„eingefangen“ werden, (5) wie die Werte in der Organisation und an
Anspruchsgruppen verteilt werden und (6) wie die Grundlogik der Schaffung von
Wert weiterentwickelt wird, um die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells in der
Zukunft sicherzustellen.
Außerdem muss man wissen, ob es
andere Leute gibt, die mit derselben Idee Geld zu verdienen suchen. In meinem
oben erwähnten Blog-Beitrag von 2016 habe ich neun verschiedene Geschäftsmodelle
gelistet, die für das Software-Geschäft relevant sind. Gassmann und
Ko-Autorinnen [2] beschreiben 55 verschiedene Muster. Bei jedem Muster gibt es einem Hinweis,
welche Unternehmen dieses Muster erfunden haben bzw. benutzen. Manche erscheinen
mir als etwas zu umfassend, etwa Digitalisierung oder E-Commerce. Andere
beziehen sich nur auf einen Aspekt des Geschäftes, wie zum Beispiel die
Zahlungsweise (Flatrate, Pay per use).
Laut
Gassmann sind es innovative Geschäftsmodelle, die die Wirtschaft mehr aufwirbeln als alle Produkt-
und Prozessinnovationen zusammen. Dabei sind 90% aller Geschäftsmodelle
Rekombinationen von vorhandenen Modellen. Die meisten Unternehmen, die
scheitern, tun dies, weil sie es versäumten ihr Geschäftsmodell anzupassen.
Geschäftsmodelle nach Gassmann [2]
Beispiele innovativer
Geschäftsmodelle
Fast alle
Unternehmen, die innerhalb der letzten 50 Jahre von sich reden machten, erreichten
dies aufgrund neuer Geschäftsmodelle. Das begann mit den Ketten von
Schnellrestaurants (engl. fast food
chains) wie McDonald, Burger King und Kentucky Fried Chicken. Neueren
Datums ist Starbucks, eine Kette, die ihr Geschäft dadurch macht, dass sie
Kaffee teurer anstatt billiger anbietet. Bekanntlich wird mit dem Ambiente, in
dem das Getränk genossen wird, ein bestimmtes Gefühl der Zugehörigkeit zu einer
Elite mitverkauft.
In der
Informatik-Branche hat Apple zwar einige richtungsweisende Produkte lanciert,
die konstant hohen Preise lassen sich nur durchhalten dank einer besonderen
Image-Pflege als Branchen-Primus. Viel wichtiger als der Erfolg mit seinen
Produkten ist die Tatsache, dass Apple den Musikmarkt total umgekrempelt hat.
Anstatt im Bündel von je 15-20 Stück werden jetzt einzelne Titel angeboten. Den
nächsten Schritt gingen Firmen wie Netflix und Spotify, die nicht die Titel
verkaufen, sondern nur das Vergnügen, einen Titel oder ein Video anzuhören bzw.
anzuschauen.
In unseren
Städten sind die Versuche allmählich sichtbar, wie man dem Erstickungsproblem,
das durch den Individualverkehr verursacht wird, entgegen wirkt. Waren die
Mietautos, auch wenn sie auf der Straße stehend angeboten wurden, noch eine Erweiterung
eines bestehenden Geschäfts, so sind dies die mietbaren Fahrräder nicht mehr.
Hier treten neue Agenten auf, sogar aus Singapur oder direkt aus China.
Disruptive und erhaltende
Innovationen
In einem vor kurzem erschienenen Buch
[4] betont Christoph Keese, ein Vorstandsmitglied des Axel Springer Verlags,
dass es vor allem disruptive Innovationen sind, die bestehende Unternehmen
gefährden. Deshalb kann es sinnvoll sein, das eigene Geschäft selbst zu zerstören,
bevor es andere tun. Normalerweise sind Unternehmen eher dazu bereit, auf
erhaltende Innovationen zu setzen. So blieben beim Übergang von Schellack-Schallplatten
auf CDs die Verteilungswege und die Preisstruktur erhalten, anders war es bei
der Einführung von Online-Musikläden und Streaming-Angeboten (wie Netflix und Spotify).
Disruptive Innovationen kommen meist von außerhalb der bestehenden Branche.
Rolle
der Technologie
Technologien
sind Wegbereiter oder Ermöglicher (engl.: enabler)
von Geschäften. Eine Technologie kann die Rahmenbedingungen eines Geschäfts
oder einer Tätigkeit total verändern oder eine völlig neue Art von Angeboten
ermöglichen. Umgekehrt gilt: Ohne ein Geschäftsmodell ist eine Technologie meist
leblos oder irrelevant.
In
einem neueren Buch [3] von Gassmann wird erklärt, dass die zurzeit so viel
gerühmte digitale Transformation meist auf einem Dreiklang beruht, der
digitalen Technik, einer Geschäftsmodell-Innovation und einer Plattform als
Angebotsrahmen. Die Plattform ist einerseits eine Architektur, andererseits ein
Ökosystem mit Nutzern und unabhängigen Entwicklern. Oft heißt es, dass Plattformen
die Bildung von Monopolen fördern. Das sehe ich anders. Sie erleichtern es
neuen Anbietern Fuß zu fassen. Diese können eine teure eigene Investition
umgehen, wenn sie sich den vorgegebenen Regeln anpassen. Viel entscheidender
ist nämlich, dass bei digitalen Produkten die Reproduktionskosten per Einheit
gegen Null tendieren. Dadurch ist der Erstanbieter bevorzugt gegenüber den
später in den Markt eintretenden Anbietern. ‚The winner takes it all‘ sang
einst die Gruppe ABBA.
Oft
ist der Plattform-Anbieter nämlich nicht in der Lage, alle Wünsche der Nutzer
abzudecken. Dann ist es für ihn sinnvoll auch Dritten den Zugang zu
ermöglichen. Das kann sehr locker erfolgen (wie bei Googles Android), oder aber
mit strenger Kontrolle von Sicherheit und Qualität (wie bei Apple).
Das
Herangehen an neue Geschäfte erfolgt in der Regel in drei Schritten: Erkunden,
Pilotieren und Ausweiten. Dabei kommt es vielfach zu Versuch und Irrtum (engl.: trial and error). Viele neue Chancen
lassen sich nur auf diese Weise ausloten. Das ist ein Punkt, bei dem Amerikaner
die Europäer regelmäßig abhängen.
Europäische
und amerikanische Anbieter
Sehr
oft wird die Meinung geäußert, dass wir, was neue Geschäfte anbetrifft, ganz
auf amerikanische Firmen angewiesen sind. Die folgenden Beispiele widerlegen
dies: Skype stammt
aus Estland (gehört heute zu Microsoft), Spotify
aus Schweden, Booking.com
aus Amsterdam und HRS
aus Köln. Flixbus ist
ein deutsches Unternehmen mit 100 Mio. Kunden und 250.000 Bus-Verbindungen in 28
Ländern. Die Firma besitzt nur einen einzigen Bus selbst. Sie bietet die
Strecke München-Berlin für 9,99 Euro an, neuerdings per Flixtrain auch die Strecke
Hamburg-Köln für 19,99 Euro. Bei der Bundesbahn kostet dies das Fünffache.
Nach
SAP ist es Wirecard,
das als zweite Informatik-Firma in Deutschland den Aufstieg in den DAX
schaffte. Bekanntlich listet der DAX die 50 wertvollsten Firmen des Landes. Wirecard,
mit Sitz in Aschheim bei München, besitzt 24.000 Kunden in der ganzen Welt, für
die es den elektronischen Zahlungsverkehr abwickelt. Darunter sind einige
andere DAX-Firmen.
Kundenwünsche
und mehr
Jeder
Marktteilnehmer muss sich Gedanken über die Wünsche seiner Kunden machen. Dabei
geht es nicht nur darum, was sie heute haben möchten. Wie sagte schon Henry Ford:
‚Wenn ich Leute gefragt hätte, was sie wollten,
hätten sie schnellere Pferde verlangt‘. Etwas moderner ist dagegen die
Aussage eines Vertreters des liechtensteinischen Werkzeugherstellers Hilti AG: ‚Unsere
Kunden wollen Löcher, keine Bohrmaschinen‘ [3].
Mit
anderen Worten, es reicht nicht heutige Kunden zu befragen. Es ist erforderlich deren Bedürfnisse
und Wünsche zu abstrahieren oder zu extrapolieren. Nicht jeder Kunde weiß, was
in Zukunft technisch möglich ist. Ein Spezialist eines Fachgebiets sollte da
einen Wissensvorsprung haben. Den muss und darf er ausnutzen, zum Nutzen der
Kunden und zu seinem eigenen Nutzen. Auch ist es nicht damit getan, nur die
Kunden zufrieden zu stellen. Wer sie begeistert, ja entzückt, hat die Nase
vorn.
Weitere
Referenzen
- Endres, A.: Geschäftsmodelle und Beschäftigungspotentiale in der Software-Industrie. Informatik Forsch. Entw. 21, 1/2 (2006), 99-103
- Gassmann, O., Frankenberger, K., Csik, M.: Geschäftsmodelle entwickeln. 2013
- Gassmann, O., Sutter, P.: Digitale Transformation im Unternehmen gestalten. 2016
- Keese, C.: Disrupt yourself. 2018